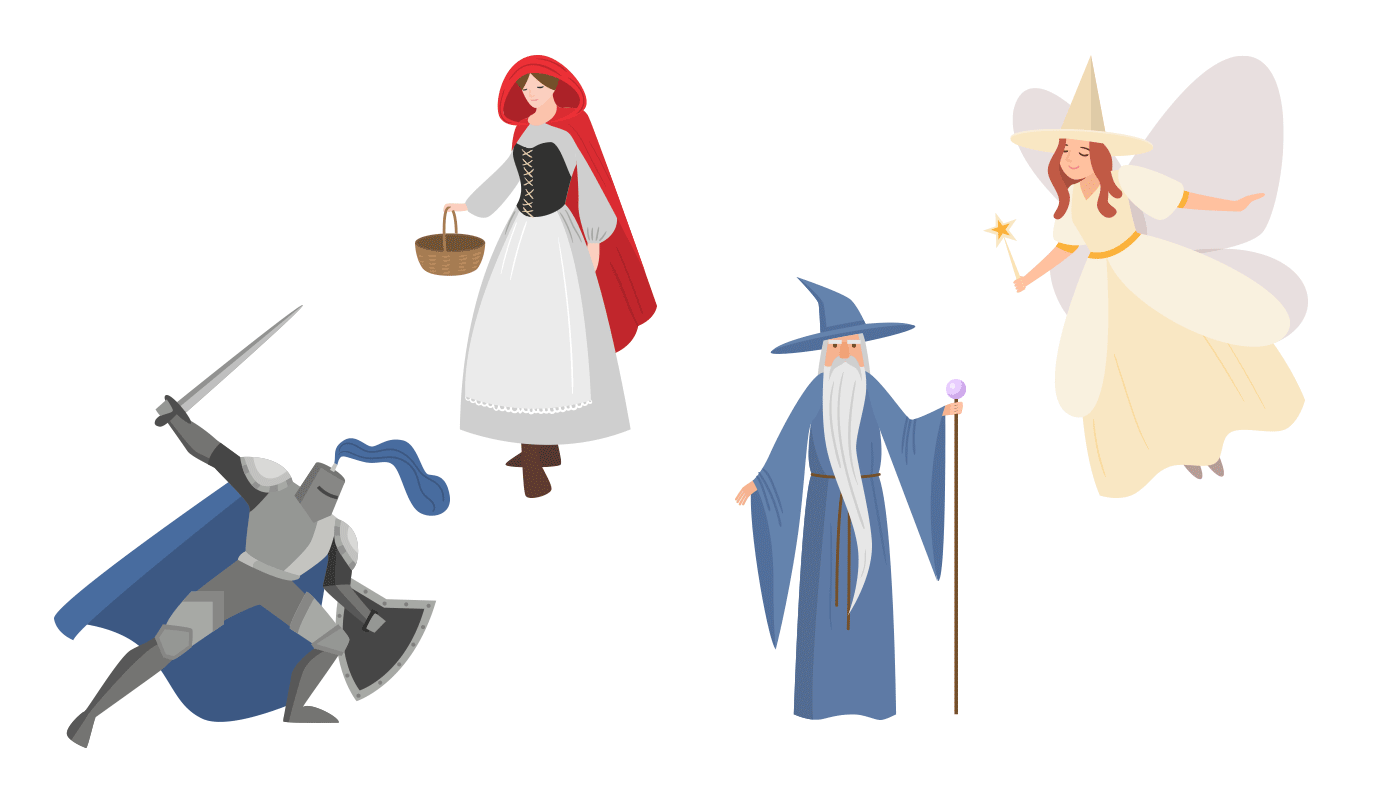2040 ist die Gesundheitsversorgung zu Hause integriert und digital
Die Co-Geschäftsführenden von Spitex Schweiz werfen einen Blick auf das Zukunftsbild «Care@Home 2040» und damit auf Gesundheitsversorgung zu Hause in 15 Jahren: Marianne Pfister umreisst, warum es künftig starke Netzwerke braucht – mit der Spitex mittendrin. Und Cornelis Kooijman geht darauf ein, wieso ebendiese Netzwerke nur mit innovativen Technologien funktionieren.
INTERVIEW: KATHRIN MORF
1) Die Wichtigkeit von interprofessionellen Netzwerken
2) Die Wichtigkeit von Technologien

Care@Home 2040:
Die Wichtigkeit von interprofessionellen Netzwerken
SPITEX MAGAZIN: Frau Pfister, wie kam es dazu, dass Spitex Schweiz 2025 auf das Zukunftsbild «Care@Home 2040» fokussiert?
MARIANNE PFISTER: Der Ursprung sind die Projekte «Health2040» 1 und «Agenda Grundversorgung» 2. Beide beschäftigen sich damit, wie die Grundversorgung 2040 aussehen muss, um einen Zugang für alle zu gewährleisten und Herausforderungen wie den Fachkräftemangel, die Alterung der Gesellschaft und die steigenden Gesundheitskosten zu bewältigen. Dabei zeigt sich, dass sich die Grundversorgung immer weiter in das Zuhause der Menschen verlagert. Dies führt dazu, dass neue Akteure – zum Beispiel die Spitäler – in das Setting Privathaushalt vordringen, für das die Spitex die Expertin ist. Darum will Spitex Schweiz mit «Care@Home 2040» ein eigenes Zukunftsbild entwickeln und die Rolle der Spitex darin definieren. Auf dieser Basis kann sich die Spitex proaktiv in die laufende Diskussion einbringen und die Zukunft mitgestalten.
Care@Home 2040 wurde am Nationalen Spitex-Kongress [vgl. Bericht] zwar noch nicht zu Ende diskutiert, aber können Sie dennoch umreissen, was das Versorgungsmodell beinhaltet?
Es umfasst alle gesundheitsbezogenen Leistungen von der Prävention bis zur Rehabilitation, die professionell zu Hause erbracht werden – medizinische Leistungen genauso wie pflegerische, betreuerische, therapeutische und soziale. Care@Home 2040 berücksichtigt Klientinnen und Klienten jeglichen Alters, Akut- und Langzeitsituationen sowie die physische und psychische Gesundheit. Ein Gesundheitsnetz aus verschiedenen Akteuren führt all diese Leistungen eng koordiniert aus, und dabei spielt die Spitex eine zentrale Rolle.

Care@Home 2040 umfasst alle gesundheitsbezogenen Leistungen von der Prävention bis zur Rehabilitation, die professionell zu Hause erbracht werden.
Marianne Pfister
Co-Geschäftsführerin Spitex Schweiz
Warum ist diese zentrale Rolle für Sie so klar?
Die Spitex kennt alle Akteure der Versorgung zu Hause genau und bringt in diesem Setting eine grosse Expertise, Erfahrung und ein breites Angebot mit, das in Europa einzigartig ist. Sie weiss genau, wie sie selbst ihre komplexesten Leistungen an unterschiedlichste Lebenswelten anpassen und dabei die Sicherheit, Privatsphäre und Autonomie ihrer Klientinnen und Klienten ins Zentrum stellen kann. Und sie arbeitet dabei auch noch effizient und wirtschaftlich. Darum ist die Spitex eine äusserst wichtige Partnerin sowie eine geeignete Koordinatorin in der Gesundheitsversorgung zu Hause.
Care@Home 2040 vertrage kein «Silodenken», sagten Sie am Kongress. Was bedeutet dies?
Im Rahmen von Care@Home 2040 muss derjenige Akteur eine Leistung erbringen, der die richtigen Kompetenzen und nötigen Erfahrungen mitbringt. Setzt beispielsweise ein Spital im Rahmen von «Hospital@Home» beziehungsweise eines «Home Treatments» die eigenen Pflegenden zu Hause ein, obwohl die Spitex für die geforderten Pflegeleistungen die geeigneten Kompetenzen besitzt, ist dies ein Silodenken, das sich an den eigenen Interessen orientiert. Care@Home 2040 braucht stattdessen ein integriertes Denken, das sich am Patientenpfad und am Bedarf der Betroffenen ausrichtet. Damit werden auch Parallelstrukturen vermieden, welche knappe finanzielle und personelle Ressourcen verschlingen.
Welche Vorteile hat Care@Home 2040 für die Klientinnen und Klienten?
Sie erhalten, was die Klientinnen und Klienten der Zukunft auch erwarten: eine individuelle, ganzheitliche, kontinuierliche und digital unterstützte Versorgung aus einer Hand – durch ein interprofessionelles Team, das Betroffene und Angehörige eng mit einbezieht. Die Vernetzung der Leistungserbringer sorgt für den Austausch aller nötigen Informationen, was Behandlungen effizient und sicher macht. Wir wissen aus Studien, dass die Genesung zu Hause oft schneller geht und das Infektionsrisiko geringer ist als im Spital. Care@Home 2040 ist aber nicht für alle Menschen das Richtige: Manche sind zum Beispiel im Spital oder Heim sicherer. Andere sind mobil genug, um ein Ambulatorium oder Gesundheitszentrum aufzusuchen. Letztendlich soll der Patient dort behandelt werden, wo er die beste Versorgung zu optimalen Kosten bekommt.
Was sind die Vorteile von Care@Home 2040 für die Mitarbeitenden?
Die integrierte Versorgung vermeidet viel unnötige Bürokratie. Die Mitarbeitenden müssen nicht dauernd Informationen «hinterherrennen». Sie können ihre Klientinnen und Klienten umfassend und in deren Lebenswelt versorgen. Und das multiprofessionelle Team sorgt für berufliche Vielseitigkeit und Flexibilität sowie zahlreiche Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung.
Und warum spart Care@Home 2040 Kosten?
Weil die integrierte Versorgung Synergien nutzt und Doppelspurigkeiten vermeidet. Die Versorgung zu Hause ist zudem meistens günstiger als ein stationärer Aufenthalt. Und weil Care@Home 2040 auch Prävention umfasst, verhindert das Modell unnötige Operationen sowie Spital- und Heimeintritte. Dies ist nachhaltig in Bezug auf die Gesundheitskosten – und übrigens auch in Bezug auf die Umweltbelastung durch das Gesundheitswesen, die aktuell sehr hoch ist.
Was benötigt unser Gesundheitssystem jetzt, um Care@Home 2040 anzustreben?
Wir benötigen Akteure mit viel Offenheit gegenüber Neuerungen. Wir brauchen gut organisierte und koordinierte regionale Netzwerke sowie digitale Systeme, welche in diesen Netzwerken die Kommunikation und den Datenaustausch zeitnah ermöglichen. Wir benötigen eine Finanzierung, welche die Kosten für Koordinationsleistungen deckt und alle Akteure für die gleichen Leistungen gleich entschädigt – beides ist heute nicht immer der Fall. Wir benötigen Personal, das für Anforderungen wie die Digitalisierung gut geschult ist. Wir müssen Berufsprofile wie Pflegeexpertinnen und Pflegeexperten APN besser etablieren, um die zunehmende Komplexität und den wachsenden Koordinationsbedarf in der Versorgung zu Hause zu bewältigen. Und wir brauchen weiterhin Freiwillige sowie Angehörige, um den Bedarf an Gesundheitsleistungen zu Hause decken zu können.
Wird die einheitliche Finanzierung ambulanter und stationärer Leistungen (EFAS) nicht zumindest die Finanzierungsprobleme lösen?
EFAS wird ab 2028 – beziehungsweise ab 2032 für die Pflege – sicherlich Anreize für Ambulantisierung und Koordination schaffen. Das neue System legt aber nur fest, wie sich Versicherer und Kantone die Gesundheitskosten teilen. Damit das System die Finanzierung von Leistungen nachhaltig verbessert, muss es nicht nur kostenneutral eingeführt werden – es muss sich auch laufend an Entwicklungen im Gesundheitswesen anpassen.
Gibt es Hinweise darauf, dass die Spitex auf dem richtigen Weg zu Care@Home 2040 ist?
Da gibt es viele: Zum Beispiel verschiedene Gesundheitsnetzwerke mit der Spitex als zentraler Akteurin, die ein breites Dienstleistungsangebot rund um die Uhr sicherstellen. Oder auch Home-Treatment-Projekte von Spitälern und Kliniken, welche die Spitex einbeziehen, sowie eine vorausschauende Aus- und Weiterbildung von Spitex-Mitarbeitenden [vgl. Bericht]. Damit Spitex Schweiz alle Projekte und Ideen kennt, die zukunftsweisend für Care@Home 2040 sind, freuen wir uns darüber, wenn uns diese gemeldet werden 3. Ich hoffe, dass die Politik viele solche Projekte finanziert, um die integrierte Versorgung voranzutreiben.
Können Sie zum Schluss ausführen, wie es mit Care@Home 2040 weitergeht?
Wir müssen Care@Home 2040 nun weiter konkretisieren und dann analysieren, was das Zukunftsbild für das künftige Dienstleistungsangebot der Spitex bedeutet und welche Massnahmen die Spitex folglich auf allen Ebenen ergreifen muss. Sicher ist bereits: Care@Home 2040 wird nur Wirklichkeit, wenn alle Akteure jetzt innovativ, mutig und gemeinsam handeln – vernetzt, professionell und zukunftsorientiert.
Übersicht: Wichtige Begrifflichkeiten in Kürze erklärt
Care@Home: «Care@Home» wird derzeit häufig verwendet und unterschiedlich definiert. Meist ist eine Gesundheitsversorgung zu Hause gemeint, in der Gesundheitsleistungen durch mehrere Akteure koordiniert erbracht werden.
Spitex: Die Spitex ist ein Teil von Care@Home und kann viele Leistungen in diesem Versorgungsmodell erbringen, aber nicht alle.
Hospital@Home (auch: «Home Treatment»): Dies ist ebenfalls ein Teil von Care@Home und bezieht sich auf Fälle, für die bisher eine Spitalbehandlung nötig war, die nun aber vermehrt von einem interprofessionellen Team zu Hause behandelt werden.
Care@Home 2040: Spitex Schweiz schärft derzeit das Zukunftsbild «Care@Home 2040». 2040 wird betrachtet, weil dies unter anderem auch die «Agenda Grundversorgung» des Bundes tut. Care@Home 2040 beschreibt eine integrierte Gesundheitsversorgung zu Hause im Jahr 2040, die alle gesundheitsbezogenen Leistungen für die unterschiedlichsten Klientinnen und Klienten umfasst. Diese werden von einem gut koordinierten, digital verbundenen Netzwerk aus professionellen Leistungserbringern erbracht, wobei die Spitex eine zentrale Rolle spielt.
Care@Home 2040:
Die Wichtigkeit von Technologien
SPITEX MAGAZIN: Herr Kooijman, wie wichtig sind Technologien, damit das Zukunftsbild «Care@Home 2040» Wirklichkeit werden kann?
CORNELIS KOOIJMAN: Care@Home 2040 sieht vor, dass viele Leistungserbringer in die Gesundheitsversorgung zu Hause involviert sind. All diese Akteure müssen die nötigen Informationen über gemeinsame Klientinnen und Klienten zeitnah austauschen können – und dies gelingt nur dank digitaler Technologien. Hinzu kommt, dass in Zukunft noch mehr hochkomplexe Pflegesituationen zu Hause behandelt werden. Dies erfordert etwa den zunehmenden Einsatz von Medizinaltechnologie.
Verfügt die Spitex über ausreichend Offenheit gegenüber solchen Technologien?
Davon bin ich überzeugt. Nicht nur unterstreicht das Swiss eHealth Barometer 4 regelmässig, dass die Spitex digitalen Neuerungen gegenüber überdurchschnittlich aufgeschlossen ist. Spitex-Mitarbeitende arbeiten auch bereits selbstverständlich mit digitalen Helfern, und Spitex-Organisationen lancieren viele Pilotprojekte zu technologischen Neuerungen. Wir beginnen also keinesfalls bei null, was die technologische Umsetzung von Care@Home 2040 betrifft.
Viele Klientinnen und Klienten sind hingegen nicht offen gegenüber modernen Technologien. Ändert sich dies bis 2040?
Bereits heute tauscht sich die Spitex über digitale Technologien wie Kundenportale mit manchen Klientinnen und Klienten oder Angehörigen aus. 2040 dürfte dies Alltag sein. Die Generation, die nun langsam alt wird, erwartet von der Spitex sogar eine starke digitale Affinität. Wichtig ist bei diesem Thema, dass die Spitex die Ängste der Klientinnen und Klienten rund um die Nutzung ihrer digitalen Daten abbaut. Und dass sie äusserst gut für die Sicherheit dieser sensiblen Daten sorgt – gerade in Zeiten, in denen die Gefahr der Cyberkriminalität immer grösser wird.
Der Datenaustausch zwischen den Leistungserbringern wird heute durch unterschiedliche, inkompatible Systeme erschwert. Ändert sich dies bis 2040?
Damit der heutige Wildwuchs aufhört, braucht es klare und verbindliche nationale Standards für Software und digitale Anwendungen im Gesundheitswesen. Ich hoffe, dass das 400-Millionen-Programm DigiSanté 5 solche hervorbringt. Wir müssen das «once only»-Prinzip erreichen: Daten sollten im Gesundheitswesen immer nur einmal erfasst werden müssen. Auch die Leistungserbringer selbst müssen darauf hinarbeiten, dass der Austausch von Daten – natürlich immer mit dem Einverständnis der Klientinnen und Klienten – einfach erfolgen kann. Zum Beispiel setzt die Spitex seit Jahren erfolgreich auf die Bedarfsabklärung mit den interRAI-Instrumenten 6. Der Verband der Alters- und Pflegeheime Curaviva/Artiset hat eine Absichtserklärung unterzeichnet, künftig ebenfalls auf interRAI-Instrumente für die Bedarfsabklärung in der stationären Langzeitpflege zu setzen. Ich begrüsse das sehr, denn verwandte Systeme mit einheitlichen Items und Codes vereinfachen den Datenaustausch stark. Und Akteure des Gesundheitswesens sollten sich an «Best Practices» orientieren, wenn sie nach technologischen Lösungen suchen, statt das Rad neu zu erfinden.

Es braucht klare und
verbindliche nationale Standards für Software und digitale Anwendungen im Gesundheitswesen.
Cornelis Kooijman
Co-Geschäftsführer Spitex Schweiz
Wird auch das elektronische Patientendossier (EPD) den Datenaustausch bis 2040 verbessern?
Das revidierte Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier (EPDG) verpflichtet voraussichtlich ab 2028 alle Leistungserbringer, sich dem EPD anzuschliessen. Gleichzeitig wird das EPD überarbeitet. 2040 wird das EPD daher weit verbreitet sein und zum Beispiel strukturierte Daten bieten. Ein gutes EPD zu haben, reicht aber nicht aus, wenn die Leistungserbringer es nicht in ihre alltäglichen Prozesse integrieren.
Spitex Schweiz betreibt den nationalen Datenpool HomeCare Data (HCD). Wie hilft dieser, eine gute Gesundheitsversorgung für 2040 zu entwickeln?
HCD liefert uns hochwertige klinische Daten über Spitex-Klientinnen und -Klienten aus der ganzen Schweiz. So können wir zum Beispiel analysieren und ausweisen, wer sie sind und welche Leistungen für ihre gute Versorgung nötig sind. Mit einem neuen, umfassenden Projekt zur Entwicklung von Spitex-Qualitätsindikatoren auf Basis der Daten aus der Bedarfsabklärung gewinnt HCD weiter an Bedeutung 7. Ich hoffe, dass sich noch mehr Spitex-Organisationen dem Datenpool anschliessen.
Technologien ermöglichen zunehmend die Gesundheitsversorgung aus der Ferne. Ist «Telepflege» 2040 Normalität?
Gewisse pflegerische oder auch ärztliche Gespräche sind sicher vermehrt per Videotelefonie möglich. Bis 2040 dürfte auch das Monitoring des Gesundheitszustandes aus der Ferne mittels Sensoren häufiger werden. Für zahlreiche Interventionen wird aber auch in 15 Jahren eine Fachperson vor Ort nötig sein.
Und wo sehen Sie die Chancen von künstlicher Intelligenz (KI) für Care@Home 2040?
Zuerst einmal: Alle Technologien dürfen nur eingeführt werden, wenn sie Prozesse der Spitex einfacher, effizienter oder sicherer machen. Sie sind Mittel zum Zweck – und nicht der Zweck. KI birgt aber durchaus Chancen: Sie kann zum Beispiel Daten und Dokumente sehr schnell durchsuchen und analysieren. Und sie kann die Effizienz beim Erfassen und beim Austausch von Daten steigern. Es wird aber immer die Expertise von Menschen brauchen, um die Ergebnisse der KI zu prüfen.
Braucht die Spitex neue Aus- und Weiterbildungen, um 2040 die nötigen Kompetenzen für all die neuen Technologien zu haben?
Selbstverständlich braucht es immer Aus- und Weiterbildungen, um im eigenen Berufsfeld à jour zu bleiben, auch für neue Technologien. So müssen digitale Kompetenzen in der Pflegeausbildung gelehrt werden, Spitex-Organisationen müssen für Weiterbildungen zu diesem Thema sorgen und die Spitex-Finanzierer müssen diese Weiterbildungen bezahlen. Auch der kompetente Umgang mit Medizinaltechnologie muss geschult werden. Bereits heute verfügen viele Spitex-Organisationen über Personal, das Medizinaltechnologie genauso kompetent einsetzt wie die Pflegenden der Spitäler, etwa für Dialysen und Beatmungen.
Spitex Schweiz hat doch aber die mangelhafte Finanzierung der Spitex-Leistungen rund um Medizinaltechnologie bemängelt?
Das ist richtig. Die Spitex kämpft oft darum, dass ihre Leistungen rund um die Handhabung solcher Geräte finanziert werden. Das Krankenversicherungsgesetz darf der Realität nicht mehr hinterherhinken: Es sollte stets festhalten, welche modernen technologischen Hilfsmittel für welche Leistungen eingesetzt werden dürfen. Wichtig sind dabei «gleich lange Spiesse»: Ambulante Leistungen müssen immer gleich finanziert werden, egal ob die Spitex oder das Spital-Personal sie im Hospital@Home-Setting ausführt.
Sie haben viele Akteure erwähnt, die gefordert sind, damit Care@Home 2040 Wirklichkeit wird. Welche möchten Sie zum Schluss auch noch nennen?
Die Kantone müssen innovative Projekte zu Technologien finanzieren, welche die integrierte Versorgung fördern, um die Versorgungssicherheit 2040 garantieren zu können. Appellieren möchte ich aber insbesondere an die Organisationen und Verbände der Spitex selbst: Wir sollten jetzt miteinander und mit anderen Akteuren innerhalb der jeweiligen Versorgungsregion die technologischen Herausforderungen der Zukunft angehen, statt auf Veränderungen zu warten. Nur dann können wir auch 2040 gut für unsere Klientinnen und Klienten sorgen – ein Ziel, das immer im Mittelpunkt unserer Bestrebungen stehen muss.

- Mit dem Projekt «Health2040» will u.a. die Universität Luzern die ambulante Gesundheitsversorgung zukunftsfähig machen. Hierfür haben 50 Stakeholder die Vision «Gesundheitsnetz für alle – pour tous – per tutti» entwickelt. Mehr: www.de.health2040.ch ↩︎
- An der «Agenda Grundversorgung» des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) wird seit November 2024 gearbeitet. Ziel ist ein zukunftsträchtiges, niederschwelliges, digital unterstütztes Versorgungsystem mit ausreichend Personal. Mehr: www.bag.admin.ch/de/agenda-grundversorgung ↩︎
- Projekte und Ideen können gemeldet werden an Ruth Hagen: hagen@spitex.ch / 031 372 07 01. ↩︎
- www.gfsbern.ch/de/news/swiss-ehealth-barometer-2024 ↩︎
- www.bag.admin.ch/de/digisante-foerderung-der-digitalen-transformation-im-gesundheitswesen ↩︎
- www.spitex-instrumente.ch/bedarfsabklaerung ↩︎
- Das «Spitex Magazin» wird zu einem späteren Zeitpunkt über dieses Projekt berichten. ↩︎